Cognizant Deutschland
Erfahren Sie wie Cognizant Ihr modernes Unternehmen entwickelt.
UNSERE EXPERTISE
Branchen im Blickpunkt
Blog

Erfahren Sie mehr über branchenspezifische Lösungen und Know-how.
Mit Belcan können Sie sich den schwierigsten Herausforderungen in F&E stellen.
Fördern Sie Ihr Unternehmen durch Spitzenleistung und Effizienz.
Gestalten Sie Ihren Wettbewerbsvorteil in der Fertigung neu.
Beschleunigen Sie das Wachstum mit kundenorientierten Lösungen.
Beschleunigen Sie die Transformation in der Automobilindustrie mit skalierbaren IT-Lösungen und der Bereitstellung generativer KI.
Personalisieren Sie Lernerfahrungen mit Bildungstechnologie und IT-Lösungen, die Lernenden das Gefühl geben, wertgeschätzt zu werden.
Verbessern Sie die Effizienz und Nachhaltigkeit mit Technologien, die die blaue Wirtschaft voranbringen.
Unsere digitalen Lösungen ermöglichen es Ihnen, Geschäftsentscheidungen auf der Grundlage von kontextbezogenen Echtzeitdaten zu treffen.
Entdecken Sie Lösungen, die die Versorgung von Millionen von Patienten verbessern und vereinheitlichen.
Entwickeln Sie Strategien für Produkt-, Service- und Prozessinnovationen, die neues Wachstum bewirken.
Vertiefen Sie die Kundenbindung, fördern Sie langfristige Beziehungen und steigern Sie die Rentabilität.
Unsere Daten- und KI-Lösungen sind auf Ihre Geschäftsergebnisse abgestimmt und sorgen für wirkungsvolle Ergebnisse.
Bauen Sie Ihre digitale Kultur mit Lösungen auf, die die Verbindung zu Ihrer Kundschaft aufrechterhalten.
Stellen Sie sich der digitalen Transformation, um ein intelligenteres, agileres und besonders leistungsfähiges Unternehmen aufzubauen.
Bieten Sie mehr Energieoptionen an, senken Sie die Kosten und steigern Sie die Kundenzufriedenheit.
Entwickeln Sie eine digitale Strategie, die Kunden zufrieden stellt und Kosten senkt.
Mit den neuesten Technologien wie IoT, maschinellem Lernen und Blockchain bleiben Sie der Konkurrenz einen Schritt voraus.
Erfüllen Sie die Anforderungen der Kunden an ein digitales, personalisiertes Online-Versicherungserlebnis, und reduzieren Sie gleichzeitig die damit verbundenen Risiken.
Vertiefen Sie Ihr Branchen-Know-how, um Ihr Unternehmen sicher in die Zukunft zu führen.
Entdecken Sie die flexiblen, maßgeschneiderten Lösungen von Belcan.
Lassen Sie KI für sich arbeiten und machen Sie aus Möglichkeiten echten Mehrwert.
Schnellere Wertschöpfung für KI in dezentralen Datenumgebungen.
Bewahren Sie eine hohe Integrität über den gesamten KI-Lebenszyklus hinweg.
Beginnen Sie das nächste Kapitel der Unternehmensleistung.
Verbessern Sie den Betrieb, erhöhen Sie die Effizienz, beseitigen Sie technische Hürden und modernisieren Sie Anwendungen für die Zukunft.
Verbinden Sie Ihre Prozesse, Mitarbeitende und Erkenntnisse im gesamten Unternehmen mit KI-fähiger IPA.
Sicherheitslösungen der nächsten Generation für erweiterten Schutz vor neuen Bedrohungen.
Stellen Sie KI in den Mittelpunkt Ihres Unternehmens, um Innovation und Wachstum zu ermöglichen.
Arbeiten Sie mit KI-gestützten Prozessen, die die Leistung steigern und Ihre Abläufe transparenter und schneller machen.
Erkennen Sie Veränderungen, optimieren Sie Abläufe und mindern Sie Risiken mit datengestützten Erkenntnissen in Quantengeschwindigkeit.
Ermöglichen Sie ein sichereres und wertorientierteres Unternehmen mit bewährten Lösungen der nächsten Generation.
Entwickeln Sie innerhalb kurzer Zeit und mit Fokus auf geschäftlichen Auswirkungen die Software von morgen.
Effizienzschub für Betriebsabläufe, Kostenoptimierung und schnellere Produktentwicklung.
Gestalten Sie das Kundenerlebnis neu, gewinnen und halten Sie Top-Talente und bestehen Sie in der digitalen Wirtschaft.
KI-gestützte Erkenntnisse zur Inspiration der Unternehmenstransformation.
Verstehen und antizipieren Sie die Bedürfnisse von Kunden, die mit KI arbeiten.
Investieren Sie in Menschen, um das Potenzial der KI zu nutzen.
Schließen Sie die Lücke zwischen starker KI-Führerschaft und Bereitschaft des Unternehmens.
Entdecken Sie mit unseren Erkenntnissen zu Gen-KI, wie das Geschäft der Zukunft aussehen wird.
Halten Sie Schritt mit den Trends, die die Zukunft der Wirtschaft prägen – und bleiben Sie in einer sich schnell verändernden Welt an der Spitze.
Entdecken Sie die wichtigsten Schwerpunktbereiche von Cognizant und unseren Kunden.
Erfahren Sie mehr über unsere zukunftsweisende Forschung und entdecken Sie neue Technologie- und Branchentrends.
Sehen Sie sich auch unsere weiteren Erkenntnisse und Forschungsergebnisse an und lernen Sie die Experten kennen, die dahinter stehen.
Erfahren Sie, wie unser Know-how Ihnen helfen kann, Chancen schneller zu erkennen und Veränderungen vorzugreifen.
Erfahren Sie mehr über branchenspezifische Lösungen und Know-how.
Mit Belcan können Sie sich den schwierigsten Herausforderungen in F&E stellen.
Fördern Sie Ihr Unternehmen durch Spitzenleistung und Effizienz.
Gestalten Sie Ihren Wettbewerbsvorteil in der Fertigung neu.
Beschleunigen Sie das Wachstum mit kundenorientierten Lösungen.
Beschleunigen Sie die Transformation in der Automobilindustrie mit skalierbaren IT-Lösungen und der Bereitstellung generativer KI.
Personalisieren Sie Lernerfahrungen mit Bildungstechnologie und IT-Lösungen, die Lernenden das Gefühl geben, wertgeschätzt zu werden.
Verbessern Sie die Effizienz und Nachhaltigkeit mit Technologien, die die blaue Wirtschaft voranbringen.
Unsere digitalen Lösungen ermöglichen es Ihnen, Geschäftsentscheidungen auf der Grundlage von kontextbezogenen Echtzeitdaten zu treffen.
Entdecken Sie Lösungen, die die Versorgung von Millionen von Patienten verbessern und vereinheitlichen.
Entwickeln Sie Strategien für Produkt-, Service- und Prozessinnovationen, die neues Wachstum bewirken.
Vertiefen Sie die Kundenbindung, fördern Sie langfristige Beziehungen und steigern Sie die Rentabilität.
Unsere Daten- und KI-Lösungen sind auf Ihre Geschäftsergebnisse abgestimmt und sorgen für wirkungsvolle Ergebnisse.
Bauen Sie Ihre digitale Kultur mit Lösungen auf, die die Verbindung zu Ihrer Kundschaft aufrechterhalten.
Stellen Sie sich der digitalen Transformation, um ein intelligenteres, agileres und besonders leistungsfähiges Unternehmen aufzubauen.
Bieten Sie mehr Energieoptionen an, senken Sie die Kosten und steigern Sie die Kundenzufriedenheit.
Entwickeln Sie eine digitale Strategie, die Kunden zufrieden stellt und Kosten senkt.
Mit den neuesten Technologien wie IoT, maschinellem Lernen und Blockchain bleiben Sie der Konkurrenz einen Schritt voraus.
Erfüllen Sie die Anforderungen der Kunden an ein digitales, personalisiertes Online-Versicherungserlebnis, und reduzieren Sie gleichzeitig die damit verbundenen Risiken.
Vertiefen Sie Ihr Branchen-Know-how, um Ihr Unternehmen sicher in die Zukunft zu führen.
Entdecken Sie die flexiblen, maßgeschneiderten Lösungen von Belcan.
Lassen Sie KI für sich arbeiten und machen Sie aus Möglichkeiten echten Mehrwert.
Schnellere Wertschöpfung für KI in dezentralen Datenumgebungen.
Bewahren Sie eine hohe Integrität über den gesamten KI-Lebenszyklus hinweg.
Beginnen Sie das nächste Kapitel der Unternehmensleistung.
Verbessern Sie den Betrieb, erhöhen Sie die Effizienz, beseitigen Sie technische Hürden und modernisieren Sie Anwendungen für die Zukunft.
Verbinden Sie Ihre Prozesse, Mitarbeitende und Erkenntnisse im gesamten Unternehmen mit KI-fähiger IPA.
Nutzen Sie Fachwissen, um große Visionen in die Realität umzusetzen.
Sicherheitslösungen der nächsten Generation für erweiterten Schutz vor neuen Bedrohungen.
Stellen Sie KI in den Mittelpunkt Ihres Unternehmens, um Innovation und Wachstum zu ermöglichen.
Arbeiten Sie mit KI-gestützten Prozessen, die die Leistung steigern und Ihre Abläufe transparenter und schneller machen.
Erkennen Sie Veränderungen, optimieren Sie Abläufe und mindern Sie Risiken mit datengestützten Erkenntnissen in Quantengeschwindigkeit.
Verwandeln Sie Nachhaltigkeitsverpflichtungen in erreichbare Meilensteine.
Ermöglichen Sie ein sichereres und wertorientierteres Unternehmen mit bewährten Lösungen der nächsten Generation.
Entwickeln Sie innerhalb kurzer Zeit und mit Fokus auf geschäftlichen Auswirkungen die Software von morgen.
Effizienzschub für Betriebsabläufe, Kostenoptimierung und schnellere Produktentwicklung.
Gestalten Sie das Kundenerlebnis neu, gewinnen und halten Sie Top-Talente und bestehen Sie in der digitalen Wirtschaft.
KI-gestützte Erkenntnisse zur Inspiration der Unternehmenstransformation.
Verstehen und antizipieren Sie die Bedürfnisse von Kunden, die mit KI arbeiten.
Investieren Sie in Menschen, um das Potenzial der KI zu nutzen.
Schließen Sie die Lücke zwischen starker KI-Führerschaft und Bereitschaft des Unternehmens.
Entdecken Sie mit unseren Erkenntnissen zu Gen-KI, wie das Geschäft der Zukunft aussehen wird.
Halten Sie Schritt mit den Trends, die die Zukunft der Wirtschaft prägen – und bleiben Sie in einer sich schnell verändernden Welt an der Spitze.
Entdecken Sie die wichtigsten Schwerpunktbereiche von Cognizant und unseren Kunden.
Erfahren Sie mehr über unsere zukunftsweisende Forschung und entdecken Sie neue Technologie- und Branchentrends.
Sehen Sie sich auch unsere weiteren Erkenntnisse und Forschungsergebnisse an und lernen Sie die Experten kennen, die dahinter stehen.
Erfahren Sie, wie unser Know-how Ihnen helfen kann, Chancen schneller zu erkennen und Veränderungen vorzugreifen.
Von der Ermöglichung adaptiver Abläufe bis hin zur Personalisierung von Kundenerlebnissen – die Zukunft der Unternehmens-KI sind Multi-Agenten-Systeme.

Wir stehen am Beginn einer neuen Ära des Handels – einer Ära, in der die Verbraucher zusammen mit ihren KI-Agenten die Regeln diktieren.
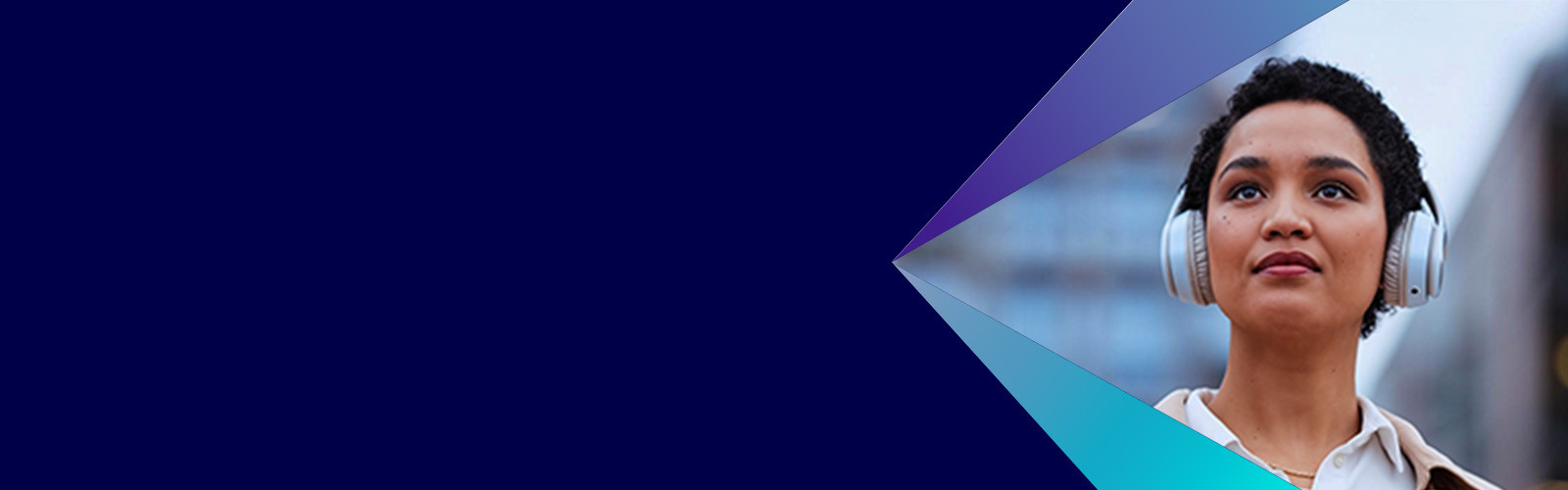
Das ist die entscheidende Frage. Da generative KI die Produktivität verbessert und die Rollenverteilung und Talentpyramide auf den Kopf stellt, müssen Führungskräfte ihre Personalstrategien an die sich verändernde Landschaft anpassen.

Die nächste Generation hyperpersonalisierter, dynamischer Erlebnisse für Kunden, Mitarbeiter und Bürger. KI-gestützte End-to-End-Transformation – Gestaltung der Erlebnisse von morgen – schon heute.
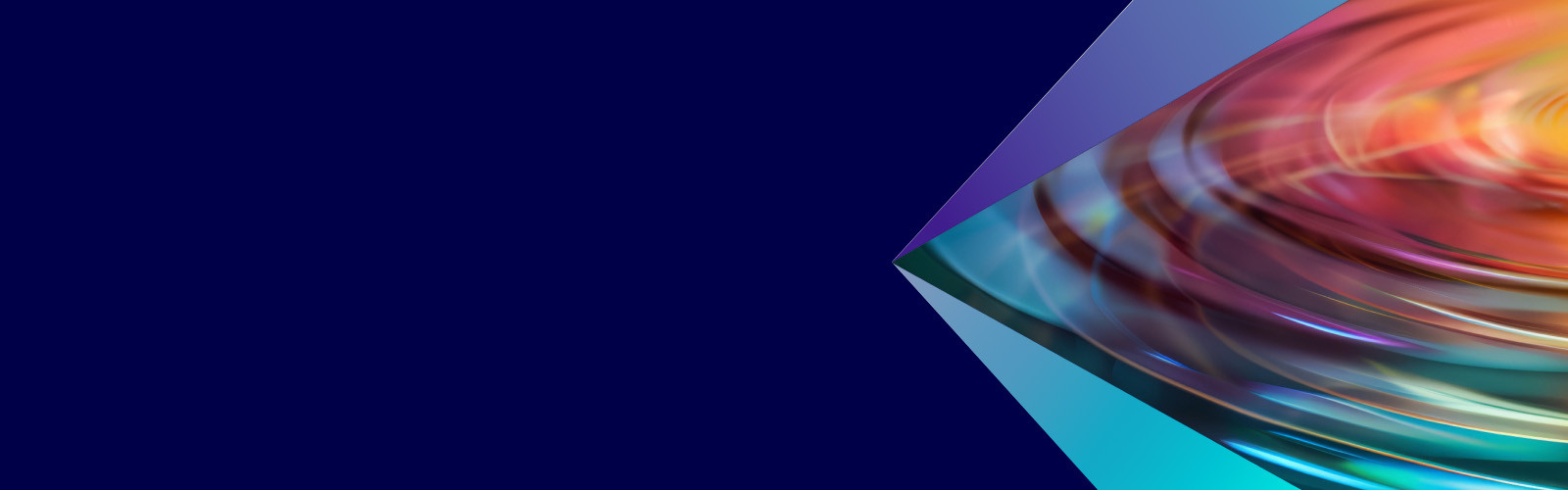
Erfahren Sie wie Cognizant Ihr modernes Unternehmen entwickelt.
Wir bieten IT- und Elektronik-Entwicklung, die Sie auf dem Weg zu einem softwaregesteuerten Unternehmen unterstützt. Mit uns bauen Sie die Zukunft der Mobilität auf – vernetzt, autonom und abonnementbasiert.
Digitale Fertigung, Analytik und Automatisierung steigern die Effizienz Ihrer Herstellungsprozesse und bieten Ihnen die Grundlage für kontextbezogene Geschäftsentscheidungen durch Echtzeitdaten.
Unsere Kunden wenden sich an uns für zukunftsfähige Technologie.
Diese Website ist durch reCAPTCHA geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.
Wir werden uns umgehend bei Ihnen melden.
Bitte versuchen Sie es erneut oder senden Sie Ihre Anfrage an inquiry@cognizant.com.

Unsere Kunden wenden sich an uns für zukunftsfähige Technologie.
Diese Website ist durch reCAPTCHA geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.
Wir werden uns umgehend bei Ihnen melden.
Bitte versuchen Sie es erneut oder senden Sie Ihre Anfrage an inquiry@cognizant.com.
